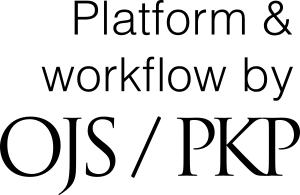Zum Tod von Ursula Ludz
Jerome Kohn (Riverhead, New York)
Ursula Ludz und ich lernten uns 1979 kennen, und zwar auf jeweilige Empfehlungen von Lotte Köhler und Mary McCarthy. Was uns miteinander verband, war Hannah Arendt, die vier Jahre zuvor verstorben war. Lotte und Mary zählten zu Arendt’s langjährigsten Freundinnen; Ursula und ich waren demgegenüber Neulinge in dem, was zu jener Zeit noch „Hannahs Stamm“ genannt wurde. Der Tag, an dem Ursula und ich uns zum ersten Mal trafen, ist mir nicht so sehr als etwas erinnerlich, bei dem zwei Fremde sofort ein unmittelbarer rapport gehabt hätte, sondern eher die gegenseitige Anerkennung natürlicher Zurückhaltung und künstlicher Reserviertheit, die einen Fremden zu erkennen geben.
Über vierzig Jahre hinweg haben wir uns dann immer wieder gesehen, oft in den wunderschönen bayerischen Bergen, in der Nähe ihres Wohnorts. Einmal verbrachten wir ein ereignisreiches langes Wochenende in Paris, als wir versuchten ein Interview Hannah Arendts mit einem französischen Fernsehsender ausfindig zu machen; bei dieser Gelegenheit hörten wir auch einen schwäbischen Großbürger, der mit entsprechendem Akzent Gedichte von Paul Celan deklamierte. Wir nahmen gemeinsam an Symposien zu Arendt in Berlin, Bremen und Oldenburg teil und sahen uns immer häufiger in oder nahe New Yorks, wohin Ursula regelmäßig zu Besuch kam. Die Zeit, die wir gemeinsam verbrachten, war immer auf Hannah Arendt konzentriert. Wir tauschten unsere Arbeiten miteinander aus und fragten einander unzählige Fragen. Ich bin mir voll und ganz bewusst, wieviel meine Arbeit unserer Freundschaft verdankt.
Ursula hat ein neues Feld der Arendt-Forschung in Deutschland eröffnet. Wie niemand vor ihr sammelte, edierte und übersetzte sie Arendts englische Schriften, von denen die ersten, so glaube ich, die Vorlesungen über Kants politische Philosophie waren (die Arendt immer als Kants ungeschriebene politische Philosophie bezeichnete). Ursula redigierte und übersetzte Texte für zwei große Aufsatzsammlungen, deren Titel die drei Zeitformen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart enthalten – ein Hinweis auf das Geflecht zeitlicher Beziehungen, das Arendt von Anfang bis Ende beschäftigte. Ursula veröffentlichte zwei Manuskripte für Bücher, die Arendt unvollendet gelassen hatte, sowie einen beeindruckenden Band, dessen Titel sich aus den Worten zusammensetzt, die Arendt an sich selbst gerichtet hatte: „Ich will verstehen“ („I Will To Understand“). Das letztgenannte Werk enthält fast 100 Seiten bibliografischer Informationen, die nicht wenige Arendt-Forscher inzwischen als ihre „Bibel“ bezeichnen. Ursulas immenses Unterfangen, zusammen mit Ingeborg Nordmann Arendts Denktagebuch herauszugeben, hat die Arendt-Forschung beispiellos beeinflusst, seit es vor zwanzig Jahren in zwei großen Bänden erschienen ist. Und schließlich, auch wenn ich wahrscheinlich andere Werke vergessen habe, gibt es mehrere Bände von Ursulas Ausgaben von Arendts umfangreicher Korrespondenz, die auch die Briefe enthält, die sie an Martin Heidegger schrieb und von ihm erhielt und die die fünfzig Jahre ihrer Beziehung umspannen.
Vor ein paar Monaten schrieb ich Ursula und bat um den richtigen Hinweis auf einen frühen Brief Heideggers an Arendt, in dem er auf ihr Zitat eines Lieblingsgedichts, Friedrich Schillers Das Mӓdchen aus der Fremde, antwortet. Ich wusste, dass ich diesen Brief gelesen hatte, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Ursula schrieb zurück und fügte eine „Kostprobe aus meiner Archivsammlung“ bei, wie sie es ausdrückte. Diese außergewöhnliche Kostprobe enthielt eine Sammlung von Arendts Bezugnahmen auf jenes Gedicht von Schiller. Es gab zum Beispiel einen Brief aus dem Jahr 1927, der nicht von Heidegger stammte, sondern an Erwin Löwenson gerichtet war, einen deutschen Juden, der nach Palästina ausgewandert war. In Sympathie mit ihm vergleicht sich die zwanzigjährige Hannah mit Schillers Mädchen: „Du hast recht“, sagt sie, „dass die Welt und alles, was mich in ihr interessiert, sich mir entzieht, und zwar gerade deshalb, weil ich eine Fremde in der Ferne bin. Ich habe meine Wurzeln verloren, und die Welt hat ihren Sinn verloren. Meine Sehnsucht nach beiden ist hart und schmerzlich.“
In Ursulas Archivsammlung befand sich ein Brief von Arendt an Heidegger aus dem Jahr 1950, fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Darin drückt sie ihr Bedürfnis aus, Heidegger zu offenbaren, wer sie ist. Sie schreibt, sie sei weder eine Jüdin noch eine Deutsche, sondern das Mӓdchen aus der Fremde! Hier nennt sie auf gewitzte Weise Schillers Gedicht im doppelten Sinne! Doch noch bevor sie Deutschland verließ, entdeckte Arendt in eben diesem Gedicht, wer sie war. Dann schickte Heidegger ihr ein Gedicht, das er für sie geschrieben hatte und dem er denselben Titel gab wie Schillers Gedicht! Tatsächlich hatten Heidegger und Arendt die Frage „Wer bin ich?“ schon Jahre zuvor erörtert (daran hatte ich mich „erinnert“). In einem Brief an Arendt, als sie noch keine zwanzig Jahre alt war, schrieb Heidegger, dass ihre Liebe zu ihm sie in ihr „innerstes Dasein“ stieß. Er fügt hinzu, dass seine Liebe zu ihr bedeute: „Ich will, dass du bist, wer du bist.“
In einem früheren Brief an mich hatte Ursula klaglos geschrieben, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war. Ich antwortete so gelassen wie möglich und sagte, dass sie mit der richtigen deutschen Pflege sicher wieder gesund werden würde. Jetzt, in diesem letzten Brief, der so voller Antworten auf meine Frage war, schrieb sie: „Danke, lieber Jerry, vielen Dank. Ich fühle mich durch Deine mitfühlende Post beschenkt. Du hast mich sehr glücklich gemacht.“
In Ursulas letzten Worten an mich kommt ein Wort aus Schillers Gedicht vor: beschenkt. Gegen Ende erinnert sich das Gedicht, dass die Magd, die von fern her angereist kommt, all jene mit einem Geschenk versieht, die sie grüßen. Einen Monat später, an einem sonnigen Septembermorgen, rief mich Roger Berkowitz an, um mir zu sagen, dass Ursula gestorben sei. Das Sonnenlicht verschwand, als ob es von einer schwarzen Wolke verschluckt worden wäre.
Sie, die abseits steht, erträgt den Schmerz des Menschseins.
Alexander R. Bazelow (Wayne, New Jersey)
Für alle, die Ursula Ludz kannten, bewunderten und mit ihr zusammenarbeiteten, ist die Nachricht von ihrem Tod ein großer Verlust, vor allem aber für die Welt der Hannah Arendt-Forschung. Als zutiefst private Person war der Raum, den sie bewohnte, der Raum der Archivforschung, ein öffentlicher Raum, in dem alle, die ein echtes Interesse haben, willkommen sind, unabhängig von Herkunft, Titeln oder persönlichem Status.
Ohne feste akademische Anstellung hat Ursula im Laufe der Jahrzehnte sowohl allein als auch in Zusammenarbeit mit anderen die Forschung zu Hannah Arendt in Deutschland umgestaltet, indem sie Texte zugänglich machte, die zuvor nur schwer erhältlich oder unbekannt waren, und dabei erhebliche eigene Mittel einsetzte. Sie sagte mir einmal, es sei nicht nur ein Privileg, diese Arbeit zu machen, sondern eine Freude.
Ihr warmherziges Wesen, die Art, wie ihre Augen leuchteten, wenn sie sich freute, ihre Liebe zu Ironie und Humor, ihr Fehlen von Groll oder Bitterkeit, obwohl sie viele Tragödien erlebt hatte, machten es erstrebenswert, mit ihr zusammen zu sein. Ihre Freude, wenn sie einen neuen Brief, einen Manuskriptentwurf, ein Tagebuch, die Herkunft einer Halskette oder eines der unzähligen Artefakte aus dem Leben einer historischen Person fand, erinnerte einen an die Freude eines Kindes, das einen versteckten Schatz findet. Es endet nie, oder besser gesagt, es endet erst, wenn das Leben endet.
Ursula liebte Poesie, und als ich nun nach ihrem Tod an sie dachte, kam mir Hart Cranes wunderschönes Gedicht zu Ehren von Herman Melville in den Sinn. Melville, der Handelsmatrose, der seine letzten Jahre als Zollinspektor verbrachte und glaubte, sein Leben sei gescheitert, wusste viel über Schiffbrüche, seien es finanzielle oder persönliche, und er wusste viele über Entdeckungsreisen. Im Gegensatz zu vielen seiner höchst erinnerungswürdigen Figuren war das Meer nicht seine letzte Ruhestätte; sie befindet sich nicht in einem spektakulären Grabmal, sondern einem einfachen Grab.
Cranes Melville-Gedicht ist subtil und ganz und gar unsentimental. Die Monodie, eine Ode, die von einem Schauspieler in einem antiken griechischen Drama gesungen wurde, kann die ertrunkenen Seeleute nicht auferwecken, ebenso wenig kann es Melville oder sonst jemand. Sie kann lediglich den Lebenden Orientierung geben. Die Geisteswissenschaften sind in dieser „Lebenswelt“ zu Hause, aber die Gelehrten sind ihr Hüter. Der Tod eines Gelehrten ist eine Tragödie für die Welt, aber wie in Melvilles großen Werken ist er eine Tragödie, die Segnungen hinterlässt.
At Melville’s Tomb
By Hart Crane
Often beneath the wave, wide from this ledge
The dice of drowned men’s bones he saw bequeath
An embassy. Their numbers as he watched,
Beat on the dusty shore and were obscured.
And wrecks passed without sound of bells,
The calyx of death’s bounty giving back
A scattered chapter, livid hieroglyph,
The portent wound in corridors of shells.
Then in the circuit calm of one vast coil,
Its lashings charmed and malice reconciled,
Frosted eyes there were that lifted altars;
And silent answers crept across the stars.
Compass, quadrant and sextant contrive
No farther tides … High in the azure steeps
Monody shall not wake the mariner.
This fabulous shadow only the sea keeps.
Hart Crane, „At Melville’s Tomb” from The Complete Poems of Hart Crane by Hart Crane, edited by Marc Simon. Copyright © 1933, 1958, 1966 by Liveright Publishing Corporation. Copyright © 1986 by Marc Simon.
Ingeborg Nordmann (Bensheim)
Die Herausgabe des Denktagebuchs von Hannah Arendt war so eng verknüpft mit der Erweiterung des Wahrnehmungsvermögens, dass wir es nicht für richtig hielten, das nähere Kennenlernen in die üblichen Formen des Miteinander zu überführen. Ohne dass wir es abgesprochen hätten, schien das eine viel größere Möglichkeit der Vertrautheit zu eröffnen. Es entstand zwischen uns eine Vielfalt von ungewöhnlichen, Distanz und Nähe gleichzeitig ermöglichenden Gesprächen.
Kurz vor ihrem Tod schrieb sie mir folgende Karte:
München, 5. Juni 2022
Liebe Frau Nordmann,
hiermit also kommt – endlich –Christa Wolfs Stadt der Engel. Ich freue mich auf die gemeinsame Lektüre und bin sicher, wir werden viel Gesprächsstoff haben.
Herzlichst,
Ihre Ursula Ludz
Roger Berkowitz (New York City)
Ich traf Ursula Ludz am 23. Dezember 2009 zum Mittagessen in Edgar‘s Café in Manhattan. Ich weiß nicht mehr, was sie in die Stadt geführt hatte, aber sie war begeistert von der Idee, in Poes altem Haus zu essen. Es war das erste von vielen Mittagessen in historischen Cafés, meist in New York City oder München. Ich besuchte sie oft, manchmal reiste ich nur dorthin, damit wir uns zum Essen treffen konnten. Einmal arrangierte sie für mich einen Vortrag in München, und wir konnten ein paar Tage zusammen verbringen. Unweigerlich diskutierten wir über die neuesten Veröffentlichungen zu Hannah Arendt, oft etwas, das Ursula aufbrachte, so dass auf jede Begegnung eine Reihe von E-Mails folgte, in denen Ursula eine Schlüsselstelle eines besprochenen Aufsatzes pointiert kommentierte.
Schon früh verband uns unser Interesse an Arendts Eichmann in Jerusalem, während sie eine Reihe von Aufsätzen zu diesem Thema für das von ihr mitbegründete Webportal Hannaharendt.net herausgab. Wir teilten unsere Frustration über die vielen Fehlinterpretationen des Buches. Zu meiner großen Zufriedenheit war sie von meiner Lesart des Endes als einer Übung in Nicht-Versöhnung angetan; und ich war begeistert, dass ich Arendts Denken über Versöhnung durch meine Lektüre von Arendts Denktagebuch, das Ursula (zusammen mit Ingeborg Nordmann) herausgegeben hat, verstehen lernte.
Ursulas zahlreiche Ausgaben von Arendts Werk und ihre hervorragenden Übersetzungen haben zu einer Arendt-Renaissance in Deutschland beigetragen. Aber es ist die Herkulesaufgabe der Herausgabe des Denktagebuchs, für die ich ihr immer dankbar sein werde. Ursula und Ingeborg haben von 1996 bis 2002 unermüdlich an dem Denktagebuch gearbeitet. Es war ein Werk der Liebe und ein unglaublicher Akt der Gelehrsamkeit, auf den Ursula zu Recht stolz war. (Als ein bissiger Rezensent, den wir beide gut kannten, die Frage stellte, ob viel Arbeit in die Ausgabe geflossen sei, schrieb mir Ursula wütend und erklärte, wie viel Bearbeitung der endgültige Text erforderte). Die Veröffentlichung des Denktagebuchs ist in der Tat eine große Errungenschaft. Es hat unser Verständnis von Arendts Denken grundlegend verändert, und es ist ein Geschenk, das Ursula und Ingeborg der Nachwelt gemacht haben.
Als ich 2012 zusammen mit Patchen Markell ein einwöchiges Seminar über das Denktagebuch in Bard organisierte, wusste ich, dass Ursulas Anwesenheit unerlässlich war (sie und ich waren enttäuscht, dass Ingeborg nicht dabei sein konnte). Ihr Beitrag zu dem Band, den wir nach diesem Seminar veröffentlicht haben, trägt den Titel „On the Truth-and-Politics Section in the Denktagebuch“. Wie Ursula darin feststellt, gibt es in Arendts Denktagebuch eine Lücke von Januar 1961 bis sie das Notizbuch im Jahr 1963 mit zahlreichen Einträgen über Wahrheit und Politik fortsetzt. Wie Ursula schreibt, entspricht diese „bemerkenswerte Lücke im Denktagebuch... einer höchst dramatischen Periode in Hannah Arendts Leben und intellektueller Biographie“. Wie so vieles, was Ursula schrieb, ist auch dieser Essay frei von Jargon und fesselnd.
Viele unserer E-Mails verbanden Diskussionen über Arendt mit Ursulas Kämpfen mit der modernen Technik. Bei einem Besuch richtete ich ein Dropbox-Konto auf ihrem Computer ein. Bald darauf schrieb sie mir, dass sie regelmäßig Nachrichten erhalte, in denen stehe: „Hallo, U.L. - deine Dropbox ist einsam ... Bitte besuche uns wieder.“ Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll.“ Als ich ihr erklärte, dass sie diese Nachrichten einfach ignorieren könne, antwortete sie mit einem umgangssprachlichen deutschen Ausdruck: „Ich habe mich „ausgeklinkt“!“ Irgendwie kannte ich das deutsche Verb „klinken“ oder das Verb „ausklinken“ nicht. Ich verstand das Wort fälschlicherweise als „auslinken“ statt „ausklinken“. Das führte zu einer Lektion in Deutsch von Ursula, die schrieb:
„Nur zur Klarstellung, eine kleine Lektion in Lexikologie! Es heißt nicht „ausge-linkt“, sondern „ausge-klinkt“. Das englische „link“ kann aber durchaus früher ein „klink“ gewesen sein. Das Bezugsverb ist „klinken“, d.h. eine „Klinke“ benutzen, z.B. eine „Türklinke“, die man „einklinken“, „zuklinken“ und, seltener gebraucht, „ausklinken“ kann. Im übertragenen Sinne kann „einklinken“ „eintreten“ und „ausklinken“ entsprechend „austreten“ oder „sich verabschieden“ bedeuten.“
Unser letztes Treffen war wieder Ende Dezember, diesmal in Bremen 2019, wohin sie gereist war, um mich zu sehen und meine Frau zu treffen, als ich den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken erhielt. Wir haben in Bremen gefrühstückt - wer hätte gedacht, dass es unser letztes sein würde.
Nicht nur die Dropbox von U.L. ist jetzt einsam.
Thomas Wild (Kingston, New York)
Wie viele, begegnete ich Ursula Ludz zunächst in Gestalt ihrer Editionen und Übersetzungen von Hannah Arendts Texten. Wer in Deutschland in den Jahren nach 1989 das Gespräch mit Arendts Denken suchte, um in jener Zeitenwende anders über Macht und Gewalt, Freiheit und Politik, Dichtung und unabhängige Geschichtsschreibung nachzudenken, arbeitete unweigerlich mit Büchern, die Ursula Ludz in die Öffentlichkeit gebracht hatte. „Menschen in finsteren Zeiten“ (1989) und „Zwischen Vergangenheit und Zukunft“ (1994) gab sie erstmals gesammelt auf Deutsch heraus. „Was ist Politik?“ (1993) sowie Arendts Briefwechsel mit Martin Heidegger (1998), beides aus dem Nachlass veröffentlicht, ermöglichte ein neues Verständnis von Arendts politischem und poetischem Denken. Und dann ist da freilich das „Denktagebuch“ (2002), ediert und kommentiert mit Ingeborg Nordmann, ohne das heute keine ernstzunehmende Lektüre zu Hannah Arendt auskommt. Und nicht zuletzt ihre kommentierte Arendt-Bibliographie – bis heute unersetzlich. Ursula Ludz hat Standards gesetzt und Bleibendes geschaffen.
Kennengelernt haben wir uns 2001 bei einer Tagung zum 50. Jahrestag von Arendts Totalitarismus-Buch in Oldenburg. Die Art, wie sie jungen Leuten, die gerade begannen, sich mit Arendt zu befassen, mit derselben Aufmerksamkeit fürs Detail, Höflichkeit und spielerischer Ironie begegnete wie den bekannten Namen, ohne jeden Dünkel, empfand ich als eindrucksvoll und ermutigend. Zehn Jahre später arbeiteten wir bei der Herausgabe eines Buches zu Hannah Arendt und Joachim Fest zusammen. Kurz vor der Drucklegung wollten uns der Cheflektor und Fests Erbe, selber ein einflussreicher Verleger, einen Buchtitel aufzwingen, von dem sie sich und uns höchst lukrative Verkaufszahlen versprachen: ein vermeintliches Arendt-Zitat, dessen Wortlaut jedoch nicht ganz stimmte und einem Text entnommen war, der in unserer Edition nicht vorkam. Frau Ludz und ich waren uns mit einem Blick einig: Etikettenschwindel! Dass die zierliche, freundliche Dame dies den beiden mächtigen Herren in der nächsten Sekunde genau so sagte, hatten diese wohl ebenso wenig erwartet, wie die Standhaftigkeit in der darauffolgenden Diskussion. Letztlich kam unser Favorit auf den Buchumschlag. Wenn wir später über die Episode lachten, dann vor allem wegen der Merkwürdigkeit, welche Macht doch Tatsachen manchmal haben können.
Ursula Ludz kam immer wieder auf zwei Grundsätze von Hannah Arendt zurück, die sie begeisterten und inspirierten: „Ich will verstehen“ sowie die Gabe, Unterscheidungen zu treffen. Ihr eigenes Verständnis von Arendts Denken suchte sie so weit wie möglich auszudifferenzieren. Welche Lektüren ‚im Sinne Hannah Arendts‘ richtig waren und welche falsch, davon hatte sie bei aller Bescheidenheit und Höflichkeit doch recht klare Vorstellungen. Aber nie wäre es ihr in den Sinn gekommen, den Diskurs mit ihrer persönlichen Sichtweise dominieren und andere ausschließen zu wollen. Ihre Hingabe galt nie dem Eigeninteresse und immer ‚der Sache selbst‘. Und damit einem weiteren Grundsatz, den Arendt in „Wahrheit und Politik“ – einer von Ursulas liebsten Essays – formulierte: Die Berichterstatterin habe nur eine Chance, Tatsachen Gehör zu verschaffen und zwar durch ihre persönliche Glaubwürdigkeit, mit anderen Worten ihre „Unabhängigkeit und Integrität“.
Antonia Grunenberg (Berlin)
Ursula Ludz gehörte zu den Menschen, die immer da waren, wenn ich eine verlässliche Auskunft über Hannah Arendts Leben und Werk brauchte. Auch in den Phasen, in denen sich der Kontakt gelockert hatte, wusste ich, dass es nur eines Briefes oder einer elektronischen Nachricht bedurfte, und schon war man im Gespräch. Und so ging es allen, die ihren Rat suchten.
Ursula Ludz war eine leidenschaftliche Philologin. Sie war ebenso genau wie unerbittlich. Kompromisse waren ihr fremd; sie wusste es eben meist besser. Ihr verdanken die vielen KennerInnen der Arendtschen Texte eine differenziertere Kenntnisweise, ein kontexterschließendes Herangehen an Texte. Sie lehrte die LeserInnen, was es heißt, die Denkweise aus der Schreibweise und vice versa zu rekonstruieren. Schnelle Meinungsbildungen aus der Lektüre eines einzigen Textes waren ihr ein Gräuel. Ihr Metier war die saubere, eindeutig belegbare Aussage anhand von Texten im Vergleich.
Ihr letztes großes, zusammen mit Ingeborg Nordmann erstelltes editorisches Werk war die Herausgabe der Notizbücher, die Arendt vom Sommer 1950 bis zu ihrem Tod geführt hatte. Diese zweibändige Notizensammlung war, neben der Bibliographie, das größte Geschenk, das Ursula (und Ingeborg) den Leserinnen und Lesern Arendts machen konnten. Das Konvolut ist eine wahre Schatztruhe für jene, die verstehen wollen, wie Arendt dachte.
Patchen Markell (Ithaca, New York)
Ich habe Ursula Ludz erst 2012 bei einem Workshop zu Hannah Arendts Denktagebuch am Bard College persönlich kennengelernt, aber sie war bereits seit vielen Jahren in meinem wissenschaftlichen Leben präsent, zunächst dank eines spiralgebundenen Entwurfs ihrer kommentierten Bibliografie von Arendts Publikationen, den mir Elisabeth Young-Bruehl Anfang der 1990er Jahre übergab. Aus diesem Dokument und aus den Anmerkungen zum Denktagebuch, das Ursula zusammen mit Ingeborg Nordmann herausgegeben hat, wusste ich, dass sie eine akribische Wissenschaftlerin mit einem beneidenswerten Blick für Details war. Was ich erst viel später erkannte, war, wie viel Freude sie daran hatte, diese Details aufzuspüren, sie mit anderen zu teilen, für die sie von Bedeutung waren, zu sagen und zu zeigen, warum sie von Bedeutung waren - und all dies auf eine Weise zu tun, die komplementär und nicht in Spannung zu ihrem Talent zu stehen schien, für ein breites Publikum zu schreiben und als Herausgeberin zu fungieren.
Ich bekam einen Eindruck davon, als ich sie in Aktion sah und mit ihr über Arendts Werk sprach und korrespondierte, aber nicht nur in diesem Zusammenhang: Meine wertvollste Erinnerung an Ursula ist ein langer gemeinsamer Spaziergang über den Campus der Freien Universität und durch die Straßen von Berlin-Dahlem, wohin wir beide 2017 zu einer Konferenz gekommen waren. (Vielleicht war es der Jetlag, aber obwohl ich mindestens einen Fuß größer und Jahrzehnte jünger war als sie, konnte ich kaum mithalten!) An jeder Ecke weckte etwas ihre Erinnerung, und während wir weitergingen, verwob sie diese in eine Geschichte, die gleichzeitig von ihrer Familie und ihrem Studium sowie von der Stadt und ihrer Geschichte handelte. Ich nehme an, es waren „Fußnoten“ in einem anderen Sinne als die, die sie veröffentlichte, aber sie hatten denselben großzügigen Geist: nicht den grauen Geist des Antiquars, sondern den Geist der leidenschaftlichen Älteren, die, um einen Satz von Arendt zu übernehmen, „auf die Details hinweist“ und zu denen sagt, die nach ihr gekommen sind: „Das ist unsere Welt.“ Diese Welt, und wir in ihr, sind ohne sie ärmer.
Marie Luise Knott (Berlin)
Ursula Ludz war so etwas wie unsere Gralshüterin. Wir, die Arendt-Forscherinnen und -Freunde haben ihr enorm viel zu verdanken. Sie hat übersetzt, sie hat herausgegeben und war bei Fragen, die man so hatte, mit ihrem enormen Wissen und ihrem privaten Wissensspeicher immer gerne behilflich. Am dankbarsten bin ich ihr persönlich für die Herausgabe des Denktagebuchs, das sie gemeinsam mit Ingeborg Nordmann mit der ihr eigenen Akribie entziffert und kommentiert hat. Großartige Einblicke in den Untergrund von Hannah Arendts Denkwege!
Immer habe ich mich bei ihrer email-Adresse – Ulu@freenet.de – gefragt, ob sie sich den Anbieter wegen der „Freiheit“ im Namen erwählt hatte. Es hätte ihr gepasst. Unsere Temperamente waren grundverschieden, nur: wir hatten die gleiche beste Freundin. Als wir beide Mitte der 1980er Jahre begannen, Hannah Arendt zu verlegen – sie bei Piper, ich bei Rotbuch –, stand wir uns im Weg. Später hat uns unsere beste Freundin umso mehr verbunden. Wir schmiedeten Pläne. 2004 entwickelten wir den Band mit Arendts Essays zur jüdischen Frage (Wir Juden), den Piper schließlich 2019 herausbrachte. Einmal, in der intensivsten Zeit der Kommentierungsarbeit daran, schrieb mir Ulu, wie ich sie für mich manchmal nannte: „Kann es sein, dass ich heute noch keine email von Ihnen bekommen habe?“ Nun werde ich keine email mehr von ihr bekommen. Sie fehlt. Schon jetzt. Sehr.
Jana Schmidt (Red Hook, New York)
„Was bringt uns zum Denken? Hegels Antwort: Versöhnung. Versöhnung womit? Mit den Dingen, wie sie sind. Aber dies tun wir irgendwie dauernd, indem wir uns in der Welt einrichten. Warum es im Denken wiederholen?“
(Hannah Arendt, Mai 1970, Denktagebuch 782)
2013-2014 verbrachte ich mehrere Monate in der Bobst-Bibliothek der New York University und in der riesigen Halle des Lesesaals der New York Public Library. Damals noch auf einem etwas prekären Studentenvisum, hielt ich mich mit einem Nebenjob über Wasser und versuchte zugleich meine Dissertation zu schreiben, die aber trotz zweijähriger Arbeit noch kaum an Kontur gewonnen hatte. Mir war nur klar, dass ich über ExilschriftstellerInnen und deren Art sich die Welt nach 1945 neu vorzustellen schreiben wollte, aber mir fehlte der Zugang, um den „Weltsinn“, der aus diesen Texten für mich erwuchs, zu erfassen. Vielleicht auch deswegen, weil ich selbst mir die Welt nur im Tenor des Verlusts vorstellen konnte.
Genau an diesem Punkt entdeckte ich das von Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann sorgfältig herausgegebene Denktagebuch. Insbesondere traf ich dort auf den Begriff der Versöhnung, der sich durch die beiden Bände zieht, vom allerersten Eintrag im Juni 1950 bis zu den letzten Fragmenten im Jahr 1970. Versöhnung war mir damals unbehaglich. Im Kontext deutscher Nachkriegsdebatten wirkte das Konzept konservativ und sogar reaktionär, ein revisionistisches Dogma mit der Intention, die Opfer zum Schweigen zu bringen. Authentischer schien eine Haltung wie die von Jean Améry, der die Versöhnung mit einer Welt ablehnte, die den Holocaust zugelassen hatte. Aber während ich Woche um Woche die schweren Bände mit mir in die Bibliothek trug, begann ich anders darüber nachzudenken. Vielleicht bot Arendts „Versöhnung mit der Welt“ einen Weg jenseits der Gegensätze von Aktiv und Passiv, Rebellion und Resignation, Bewältigung und Trauer. Durch Normanns und Ludz‘ beziehungsreiche Kommentare schien sich diese Möglichkeit zu eröffnen. So verknüpft beispielsweise eine Fußnote zum ersten Eintrag des ersten Bandes des Denktagebuchs dieses Arendtsche Fragment zu Vergebung, Rache und Versöhnung mit dem Gedicht „Mnemosyne“ von Friedrich Hölderlin: „Und vieles / Wie auf den Schultern eine / Last von Scheitern ist / zu behalten“. Die Figur einer Last von Scheiten, die zugleich auch ein Scheitern ist, und die Idee, sein Scheitern zu behalten empfand ich als geradezu revolutionär. Versöhnung, die sich der Resignation öffnet, statt diese abzuwehren, begibt sich jenseits der binären Logik in die Richtung einer Versöhnung mit dem Scheitern. Das Denktagebuch eröffnete meinem Denken damit einen Ort – und eine Welt in einer Fußnote. Dafür danke ich Ursula Ludz.
Waltraud Meints -Stender (Hannover)
Ursula Ludz wird fehlen. Ihr leidenschaftliches Engagement für das Werk von Hannah Arendt, ihr Beharren auf die Präzision der Editionsarbeit, ihr Dringen auf die Einhaltung des „Arendtschen Geistes“, der für sie ein liberaler im besten Sinne war, ihre widerständige Bereitwilligkeit in den kontroversen Diskurs zu gehen, um Arendts Vermächtnis zu bewahren, ihre heitere Streitbarkeit, die sich als Zuwendung den Anderen gegenüber zeigte.
Stefanie Rosenmüller (Dortmund)
Ihre gemeinsame herausgeberische Arbeit mit Ingeborg Nordmann, die sich durch Akribie und Hartnäckigkeit auszeichnete, hat nicht nur die Arendt-Lektüre meines Studiums und das meiner Generation durch verantwortungsbewusste und pointierte Hintergrundinformationen und engagierte Entscheidungen geprägt.
Sie war auch als Charakter beeindruckend, denn sie wirkte ganz unbestechlich durch Status, Eitelkeit oder Ruhm. Ihr geradezu altmodisches Pflichtbewusstsein, mit dem sie pünktlich ‚ihre Hausarbeiten‘ erledigte, war ganz an Vollständigkeit und Genauigkeit orientiert. Sie konnte dabei ebenso trocken deutliche korrigierende Hinweise formulieren wie auch die eigenen Korrekturaufgaben annehmen und umgehend einarbeiten.
Eine zierliche Person, die durch ihre Disziplin sehr aufrecht wirkte und oftmals spröde in ihrer Zurückhaltung, aber niemals kühl und niemals kapriziös.
Ich wäre ihr gern weiter begegnet.
Helene Tieger (Catskill, New York)
Als Archivarin des Bard College habe ich Ursula Ludz in sehr guter und warmer Erinnerung. Ihre unendliche Höflichkeit ist unvergesslich. Sie kam bereits zu uns, um mit den Beständen der Bibliothek Hannah Arendts zu arbeiten, bevor wir einen offiziellen Lesesaal dafür hatten. Wir richteten ihr in der Nähe der Ausleihtheke einen Arbeitsplatz ein, räumten den Hefter, die Büroklammern und den Papierschneider weg, damit sie sich mit einem Stapel Arendt-Bücher dorthin setzen konnte. Die Studierenden drängten sich um sie herum und suchten nach dem Hefter, aber sie war ganz in ihre Arbeit vertieft. Und trotz dieses chaotischen Umfelds lächelte Ursula Ludz immer und wiegelte am Ende ihrer Besuche jede Entschuldigung ab. Sie war sichtlich glücklich, dass sie trotz allem mit Arendts Büchern arbeiten konnte. Ich glaube, Ursula Ludz war der eigentliche Grund für die Einrichtung des Lesesaals, der heute täglich Wissenschaftler aus aller Welt willkommen heißt.
Thomas Meyer (Berlin)
„Hannah Arend und Martin Heidegger – eine Freundschaft?“ So wurden Ursula Ludz und ich als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion in München in der Süddeutschen Zeitung am 28. Mai 1998 angekündigt. Dort stand „Arend“, wohl ein unkorrigierter Übermittlungsfehler. Aber beim erneuten Lesen der fast 25 Jahre alten Notiz war es erneut der Eindruck, wir hätten da etwas Unvollendetes aufgeführt, etwas, bei dem Wesentliches fehlte und doch wusste jeder, worum es geht. Unvollendet, denn hinter dem Titel stand nicht das Problem der Beziehung zwischen Arendt und Heidegger, sondern ein Buch, das Ursula Ludz in Kürze herausgeben würde.
Der Andrang des Publikums war riesig. Es musste ein größerer Raum gefunden werden. Ich war damals Doktorand, Ursula Ludz bereits eine der bedeutendsten Herausgeberinnen und Übersetzerinnen von Hannah Arendts Werken in Deutschland. von Ich bilde mir ein mich zu erinnern, wie ruhig und konzentriert Frau Ludz war, während ich die Rolle des Störenfrieds einnehmen wollte. Der Nazi Heidegger gegen die Jüdin Arendt, das war die Konstellation, die ich im Sinn hatte – notfalls gegen Arendt und dabei die Tatsache ausnutzend, so meine Idee, dass Frau Ludz ja beiden Seiten gerecht werden musste. Es sollte eine hitzige Debatte geben. Und die gab es auch.
Es wäre falsch, wenn ich diese erste Begegnung mit Frau Ludz in irgendeiner Weise mit meinem späteren Interesse an Hannah Arendts Leben und Werk verbinden würde. Wir hatten zudem, fast bis zuletzt, Auseinandersetzungen, mehr oder weniger scharfe. Ich habe nicht immer verstanden, warum sie etwas so und nicht anders machte. Das habe ich ihr gesagt, geschrieben, mal öffentlich, mal privat. Sie hat stets reagiert, mal öffentlich, mal privat. Und sie hat mich wissen lassen, dass ich nicht glauben sollte, ich hätte das Arendt-Rad neu erfunden. Alles in allem: Es gab einen Austausch in den letzten Jahren, den ich nicht missen möchte.
Jetzt, da Frau Ludz tot ist, lässt sich ihr Werk überblicken. Ich bin ihr für Kritik, Widerspruch und Zustimmung dankbar. Denn es ist ja so: Ohne Ursula Ludz wäre Hannah Arendt in Deutschland weiterhin der interessante Fall einiger SpezialistInnen. Das zu sagen, ist das Mindeste, was selbst diejenigen, die von Frau Ludz‘ Arbeit nicht immer überzeugt waren, ihr jetzt zugestehen sollten. Gott sei Dank habe ich ihr das immer wieder gesagt.
Wolfgang Heuer (Berlin)
Wir sind nur Besucher auf dieser Welt, und Ursula Ludz ist gegangen, ohne dass wir uns von ihr verabschieden konnten. So unerwartet, weil sie vielleicht ihr Privates nicht öffentlich machen wollte und zumindest ich erst wenige Tage vor ihrem Tod erst von ihrer Erkrankung erfuhr. Vielleicht auch deshalb, weil wir während der Pandemie die Kontakte innerhalb der Redaktion von HannahArendt.net per Zoom auf das Sachliche reduziert hatten. Unerwartet scheint mir aber ihr Fortgang vor allem auch deshalb zu sein, weil Ursula Ludz so gegenwärtig war und dadurch wie niemand sonst die Arendt-Forschung in Deutschland geprägt hat, ob mit der Herausgabe zahlreicher Schriften Arendts oder mit bereitwilligem Rat, wenn jemand etwas in Arendts Nachlass suchte. Sie war in ihrer Arbeit peinlich genau, aber in ihren wachen Augen flackerten auch Humor und Engagement. Sie las noch im hohen Alter Neuerscheinungen und konnte gelegentlich in gewohnt kritischer Haltung feststellen: Nun, das ist auch nicht der große Wurf. Es war diese Konstanz und Zuverlässigkeit jahrzehntelang, die ihr den Anschein der Zeitlosigkeit gaben und ihren Tod so unwirklich erscheinen lassen.